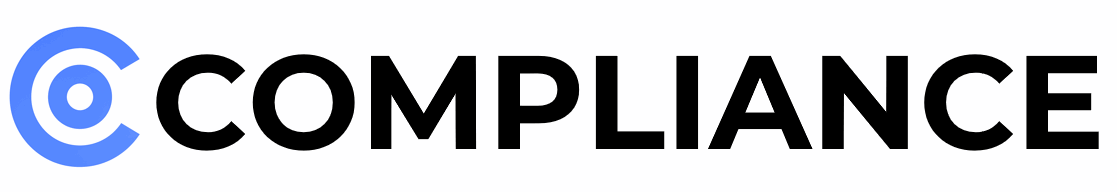Einführung: Umweltstrafrecht auf europäischer Grundlage
Mit der Richtlinie (EU) 2024/1203 hat die Europäische Union einen bedeutenden Schritt zur Stärkung des Umweltstrafrechts getan. Ziel der neuen Regelung ist es, Umweltkriminalität wirksam zu bekämpfen, EU-weit zu harmonisieren und durch hohe Strafandrohungen abzuschrecken. Für Unternehmen bedeutet das: neue Risiken, erweiterte Pflichten – und akuten Handlungsbedarf im Bereich der Compliance.
Was regelt die Richtlinie (EU) 2024/1203?
Die EU-Umweltstrafrechtsrichtlinie 2024/1203, in Kraft seit Mai 2024, ersetzt die bisherige Richtlinie 2008/99/EG vollständig. Sie enthält:
- Einen deutlich erweiterten Katalog an Umweltstraftaten (von 9 auf über 20 Tatbestände),
- Strafrahmen für natürliche Personen (bis zu 10 Jahre Freiheitsstrafe),
- Spezielle Sanktionen gegen Unternehmen, u. a. Geldstrafen bis zu 5 % des Jahresumsatzes oder 40 Mio. €,
- Einführung sogenannter qualifizierter Straftatbestände bei großflächigen Umweltzerstörungen (vergleichbar mit einem „Ökozid“-Tatbestand),
- Maßnahmen zur Förderung der grenzüberschreitenden Strafverfolgung und zur besseren Durchsetzung des Umweltrechts.
Die Richtlinie muss von den EU-Mitgliedstaaten – also auch von Deutschland – bis 21. Mai 2026 in nationales Recht umgesetzt werden.
Neue Straftatbestände im Umweltstrafrecht
Zu den neu eingeführten bzw. verschärften Straftatbeständen zählen insbesondere:
- Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen,
- Illegales Schiffsrecycling (Beaching),
- Verstöße gegen das Chemikalienrecht (z. B. REACH, POP),
- Umweltschäden durch illegale Wasserentnahme oder Luftverschmutzung,
- Verstöße im Bereich Treibhausgasemissionen,
- Verletzungen artenschutzrechtlicher Vorschriften (z. B. Handel mit geschützten Arten),
- Umfassende Umweltzerstörung mit „irreversibler Schädigung“ großer Ökosysteme (qualifizierter Tatbestand mit hohem Strafmaß).
Auch der Missbrauch behördlicher Genehmigungen wird strafbar: Liegt eine offensichtlich rechtswidrige Genehmigung vor, schützt sie nicht mehr vor Strafverfolgung – eine fundamentale Abkehr vom bisherigen deutschen Grundsatz der verwaltungsrechtlichen Akzessorietät.
Strafrahmen: Geldstrafen, Haft, Unternehmensauflösung?
Ein zentrales Novum der Richtlinie (EU) 2024/1203 ist der verbindliche Sanktionsrahmen:
- Für natürliche Personen: Je nach Schweregrad drohen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe, bei Todesfolge sogar mindestens 10 Jahre.
- Für Unternehmen: Geldstrafen von mindestens
– 3 % des weltweiten Jahresumsatzes oder 24 Mio. € bei „normalen“ Verstößen,
– 5 % oder 40 Mio. € bei qualifizierten Straftaten.
Zusätzlich können Gerichte u. a. anordnen:
- Wiederherstellung geschädigter Umweltbereiche,
- Ausschluss von öffentlichen Vergaben oder Fördermitteln,
- Entzug von Betriebserlaubnissen oder gar
- gerichtliche Auflösung des Unternehmens.
Damit wird das Umweltstrafrecht 2024/1203 zu einem echten Risikofaktor für Unternehmensführungen und Aufsichtsgremien.
Bedeutung für Unternehmen: Compliance als Präventionsmaßnahme
Die verschärften Regeln verlangen von Unternehmen deutlich mehr Eigenverantwortung. Eine funktionierende Compliance-Struktur wird künftig nicht nur präventiv, sondern auch sanktionsmindernd oder haftungsvermeidend relevant.
Empfehlungen für Unternehmen:
- Risikoanalyse erweitern: Identifizieren Sie umweltrelevante Tätigkeitsbereiche (z. B. Abfallentsorgung, Emissionen, Gefahrstoffe).
- Compliance-Management-System (CMS) aktualisieren: Ergänzen Sie umweltbezogene Vorgaben in Ihr CMS. Die Integration mit ISO 14001 oder EMAS kann ein effektives Signal sein.
- Schulungen und Awareness-Maßnahmen: Sensibilisieren Sie Mitarbeitende für neue Umweltstrafnormen und Haftungsrisiken.
- Dokumentation und Nachverfolgbarkeit: Lückenlose Dokumentation ist essenziell für Exkulpation im Fall einer Umweltstraftat.
- Whistleblowing und Hinweisgeberschutz: Fördern Sie interne Meldesysteme für umweltrelevantes Fehlverhalten.
Viele Unternehmen haben Umwelt-Compliance bislang unter dem Radar geführt. Mit der Richtlinie 2024/1203 wird sie zur Pflichtaufgabe der Unternehmensleitung.
Umsetzung in Deutschland: Was kommt auf das nationale Recht zu?
Deutschland muss nun das Strafrecht, das Ordnungswidrigkeitenrecht und verwaltungsrechtliche Regelungen anpassen. Es ist u. a. zu erwarten:
- Erweiterung von § 330 StGB (Umweltstraftaten) um neue Delikte,
- Anpassung der §§ 30, 130 OWiG oder Schaffung eines neuen Unternehmensstrafrechts zur Erhebung von Geldbußen oberhalb der bisherigen 10-Mio.-Grenze,
- Korrektur der verwaltungsrechtlichen Genehmigungswirkung (z. B. § 44 VwVfG),
- Einführung eines neuen Straftatbestands für Umweltzerstörung, analog zum „Ökozid“-Begriff.
Wie der Gesetzgeber diese Umstellungen konkret vornimmt, wird in den nächsten Monaten politisch und rechtlich intensiv diskutiert.
Fazit: Compliance muss Umweltstrafrecht neu denken
Mit der Richtlinie (EU) 2024/1203 setzt die EU klare Signale: Umweltkriminalität soll konsequent verfolgt und Unternehmen stärker in die Verantwortung genommen werden. Für Compliance-Verantwortliche bedeutet das eine strategische Neuausrichtung. Die Verbindung von Umweltstrafrecht und unternehmerischer Compliance ist keine Option mehr – sie ist notwendige Verteidigungslinie gegen existenzielle Risiken.